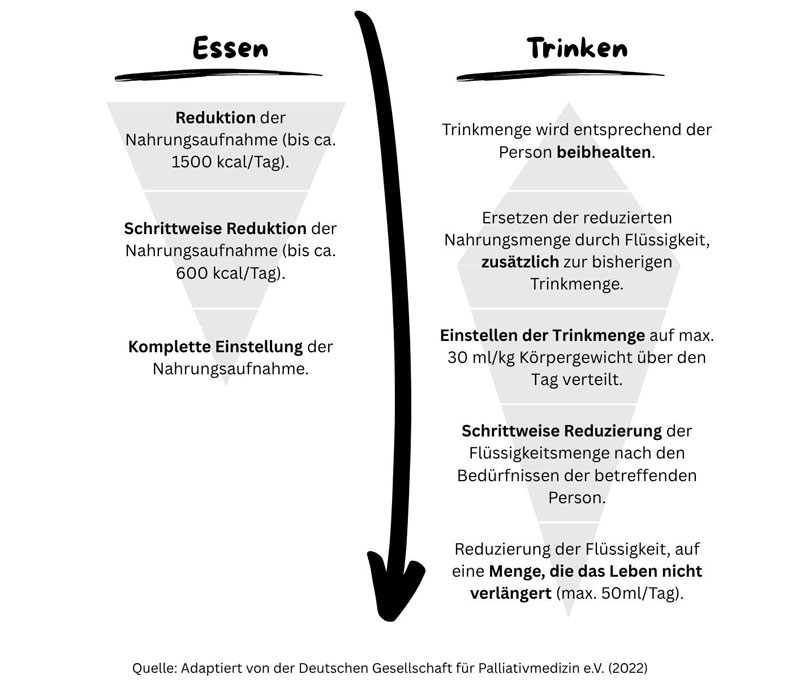Der Entschluss zum freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken setzt die Entscheidungsfähigkeit der betroffenen Person voraus.
Idealerweise gehen dem FVET mehrere offene Gespräche voraus, in denen die Entscheidung ausführlich besprochen und dokumentiert wird.
Dabei sollten die versorgenden bzw. begleitenden Personen ausreichend klären, welche Hintergründe den Sterbewunsch auslösen. Auch sollten bisherige palliative und pflegerische Maßnahmen reflektiert werden und überprüft werden, welche alternativen Handlungsmöglichkeiten zum FVET bestehen.
Grundsätzlich sollte der FVET unter Einbezug aller relevanten Akteur*innen gut vorbereitet werden.
Wesentliche Aspekte sind unter anderem die Aufklärung über mögliche Belastungen während des FVET sowie die Einbindung von An- und Zugehörigen in Rücksprache mit der betroffenen Person. Außerdem sollte die Einbindung verschiedener Fachpersonen erfolgen, wie Palliativmedizinerinnen, Psychologinnen oder Seelsorger*innen, um die betroffene Person umfassend begleiten zu können.